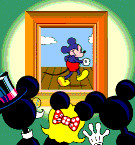

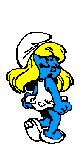
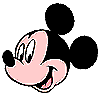
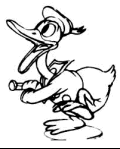
Comicgeschichte
Ursprung, Geschichte und Besonderheiten des Comics
Diese Seite behandelt weniger die Geschichte des Comics, darüber gibt es schon ausführlichere Seiten, z. B. Theorie und Geschichte des Comics, sondern ich möchte hier vor allem auf die Vorläufer des Comics und die Besonderheiten der einzelnen Figuren sowie ihrer Schöpfer eingehen.
Seit der Mensch in der Lage war, seine Umwelt künstlerisch abzubilden, hat er auch versucht, an Wänden, auf Holz, Stein, Knochen, Ton und weiteren Materialien, die Abfolge der Geschehnisse in Bildstreifen festzuhalten. Diese Bildstreifen waren die Vorläufer des Comic-Strips, der ja auch eine Geschichte in Bildstreifen darstellen möchte.
Die ältesten Darstellungen derartiger Geschehnisse sind die Jagdsituationen, die unsere Vorfahren in den Höhlen in Nordspanien (z. B. Altamira) und Südfrankreich (z. B. Lascaux) oder später auch an Felswänden darstellten. Von hier führt der Faden direkt ins alte Ägypten oder nach Mesopotamien, z. B. zu den Assyrern, die sich gern der Bildstreifen bedienten.
Bei den Griechen wurden Bildstreifen vor allem in Form von Reliefs oder Vasenmalereien verwendet, um die Götter oder auch, wie hier, die Athleten zu ehren. Die Römer machten durch Bildstreifen auf ihren Säulen und Triumphbögen den Besiegten mehr als deutlich, wer hier das Sagen hatte. Und die Besiegten verstanden diese Hinweise, auch ohne Latein zu können.
Der wohl gewaltigste Bildstreifen ist der Teppich von Bayeux . Dieser Wandteppich entstand kurz nach 1066, als die Normannen bei Hastings unter Herzog Wilhelm dem Eroberer die Angelsachsen unter König Harold besiegten. Die Stickereien sollen unter Anleitung von Herzogin Mathilde, Wilhelms Gemahlin, entstanden sein. Dieser Teppich, der wohl bedeutendste „Comic“ der Christenheit, schildert eindrucksvoll und lebendig das mittelalterliche Leben. Jede der 72 Szenen ist mit einer kurzen Erklärung in lateinischer Sprache versehen, quasi die Sprechblasen der damaligen Zeit. Insgesamt zeigt der Teppich über 1500 Einzelfiguren. Er ist auch für Astronomen interessant, dürfte er doch die älteste Darstellung des Halleyschen Kometen enthalten, der 1066 zur Zeit der Schlacht von Hastings auftauchte.
In der Gotik wurde es wichtig, die Gläubigen durch möglichst imposante Kirchen zu beeindrucken. Dadurch sollte die Größe Gottes und indirekt die Größe des Kirchenherrn demonstriert werden. Da durften natürlich auch die Bildstreifen nicht fehlen. In der Renaissance setzte sich diese Tradition fort, wie man bei diesen Bildern aus dem Portal des Baptisteriums (Taufkirche; um in die „richtige“ Kirche zu dürfen, musste man erst einmal getauft sein!) von Florenz sieht.
In der Renaissance werden erstmalig auch die bildnerischen Mittel des Comics, wozu auch Verzerrung und Übertreibung gehören, bewusst eingesetzt. Hier ragt Mathis Neithart, genannt Grünewald, vor all den Künstlern, die wir ob ihres Realismus’ bewundern (Leonardo, Michelangelo, Dürer, Holbein) heraus. Sein „Isenheimer Altar“ ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der Bildstreifen und auch für die Entwicklung unmöglicher Objekte (siehe auch meine Seite http://www.prismenfernglas.de/optik.html ). In den Bildstreifen wird die Geschichte Jesu von der Verkündigung des Engels an Maria bis zur Himmelfahrt gezeigt. Sehr aufschlussreich ist die Kreuzigungsszene, von der wir hier ein Detail sehen. Die deutende Hand des Johannes ist unnatürlich groß, aber so, dass es noch harmonisch erscheint, ebenso die Handteller des gekreuzigten Christus. Das Kreuz, an dem Christi hängt, hat oben eine andere Perspektive als unten, ein frühes unmögliches Objekt und ein Stilmittel, das gerne in Comics verwendet wird.
Vom Mittelalter bis zum Erscheinen der Zeitungen waren die Menschen auf die fahrenden Bänkelsänger angewiesen, die beim Erzählen ihrer Geschichte die Tradition der Bild-Zeitung vorwegnahmen: denn erstens wurden die Geschehnisse natürlich übertrieben und zweitens durch Bildstreifen illustriert.
Die romantischen Künstler und die Satiriker nahmen sich im 18. und 19. Jahrhundert des Bildstreifens an. Wie man an dieser Illustration zum Goethe-Gedicht „Die wandelnde Glocke“ sieht, beherrschte bereits Ludwig Anton Richter (1803-84) die Stilmittel der späteren Comics. Zeitgleich wie Richter entwickelte der satirische Maler Jean-Ignace-Isidore Gérard (1803-47), genannt J. J. Grandville um 1832 seine anthropomorphen Tiere, Karikaturen von Menschen in Tierform und Vorläufer von Donald Duck, Mickey Mouse und anderen. Auch Richter befasste sich mit solchen Darstellungen, besonders gute Arbeiten auf diesem Gebiet sind uns jedoch von Wilhelm Kaulbach (1805-47) überliefert, etwa um 1841, wie hier. Auch spätere Grafiker, wie Andreas Paul Weber (1893-1980) haben derartige anthropomorphe Wesen im Sinne der Karikatur verwendet.
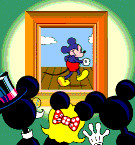
Jetzt kommen wir allmählich zu den eigentlichen „Vätern“ des Comics. Allgemein gilt Wilhelm Busch (1832-1908) mit „Max und Moritz“ (1865) als „Vater“ des Comics, denn diese „Lausbuben“ waren ja die Vorbilder für die ersten Comic-Figuren „Yellow Kid“ (1895) und die „Katzenjammer Kids“ (1897). Der Ursprung des Comics liegt also in Deutschland. Doch der eigentliche „Vater“ ist ein anderer.
Im Jahre 1845 brachte ein gewisser Heinrich Kinderlieb seine „Lustige Geschichten und drollige Bilder“ auf den Markt. Diesen wurde sofort ein Bestseller, der es auf 500. Auflagen brachte und in alle bedeutenden Sprachen übersetzt wurde. Ab der 3. Auflage hieß das Buch nach seiner bedeutendsten Figur nur noch „Struwwelpeter“ und ab der 5. Auflage traute sich der Verfasser, der um sein Ansehen als Arzt gefürchtet hatte, seinen richtigen Namen anzugeben. Er hieß nicht „Heinrich Kinderlieb“ sondern „Dr. Heinrich Hoffmann“ und war Irrenarzt. Ursprünglich hatte er nur nach einem schönen Kinderbuch für sein vierjähriges Söhnchen Carl gesucht. Da er nichts Brauchbares fand, schuf er selbst etwas derartiges. Erst Verwandte hatten ihn gedrängt, das Buch zu veröffentlichen. Er machte ein Vermögen damit, das er zum Aufbau der fortschrittlichsten Nervenheilanstalt der Welt verwendete. Damals wurden die „Irren“ wie Vieh behandelt. Hoffmann (13.6.1809 – 2.9.1894) erfand für sie „Beschäftigungstherapie“ und „Gestaltungstherapie“ und musizierte mit den Kranken. Und das lange vor den Psychologen des 20. Jahrhunderts die diese Erfindungen für sich in Anspruch nahmen. Er hatte den Comic erfunden, 20 Jahre vor Wilhelm Busch.
Letzterer hatte jedoch den größeren Erfolg, da er sich besser vermarkten konnte. Außerdem waren seine Reime besser, das muss man ihm lassen. Sie sind heute noch zitierfähig, z. B. „aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt!“ (Plisch und Plum) „Max und Moritz“ ist zum berühmtesten Kinderbuch aller Zeiten geworden und wurde in 40 Sprachen und Dialekte übersetzt. Der Jurist (Strafrechtler) Jörg-Michael Günther findet in seinem Buch „Der Fall Max und Moritz“ (Eichborn) jedoch, dass es „aus einer in der Literatur fast beispiellosen Aneinanderreihung von Straftaten besteht.“ Mehr dazu auf dieser Homepage
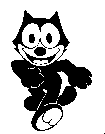
Dann schlug die eigentliche Geburtsstunde des Comics, jedenfalls aus Sicht der Puristen (die „Struwwelpeter“ von 1845 und „Max und Moritz“ von 1865, deutsche Erfindungen, nicht gelten lassen): Am 5. Mai 1895 erschien in der Sonntagsbeilage der New York World eine Zeichnung von Richard Felton Outcault, die den Lausbuben „Yellow Kid“ zeigte. Die New York World gehörte Joseph Pulitzer und als sein Konkurrent William Randolph Hearst den Erfolg dieses Comics sah, beauftragte er 1897 den deutschstämmigen Zeichner Rudolph Dirks „something like Max and Moritz“ für seine Zeitung, das New York Journal zu machen. So entstanden die „Katzenjammer Kids“. Pulitzer und Hearst lieferten sich bald einen erbitterten Konkurrenzkampf und warben sich gegenseitig die Zeichner ab. Denn die Comics waren vor allem ein Erfolg bei den Massen von sprachunkundigen Einwanderern, die oft auch noch Analphabeten waren.
Hier beginnt die eigentliche Geschichte des Comics, zu der es, wie schon erwähnt umfangreichere Seiten gibt, z. B. diese „Theorie und Geschichte des Comics“
(allerdings vernachlässigt sie die Bedeutung von Lurchi, Mecki, Globi und Rolf Kauka für den deutschen Comic und interessiert sich auch gar nicht für Popeye, der älter als Donald Duck und die Mickymaus ist, das ist gewisslich war). Aber ich denke, so intensiv hat noch nie jemand die Ursprünge des Comics beleuchtet. Statt der Geschichte des Comics deshalb nur die Geburtsdaten einiger bedeutender Figuren. Danach werde ich auf die Besonderheiten dieser Figuren (und ihrer Schöpfer) näher eingehen – wie immer mit hervorragendem Bildmaterial.
Geburtstage/-daten der Comicfiguren
INTERNATIONAL
Struwwelpeter 1844/45 (Heinrich Kinderlieb = Heinrich Hoffmann)
Max und Moritz 1865 (Wilhelm Busch)
Yellow Kid 5. Mai 1895 (Richard Felton Outcault)
Katzenjammer Kids 12. Dezember 1897 (Rudolph Dirks)
Felix the Cat 1917 (Pat Sullivan)
Thimble Theater (Olive Oyl, Han Gravy) 27. Dezember 1919 (Elzie Crisler Segar)
Tintin (Tim u. Struppi) 1927 (Hergé = George Remi)
Tarzan 7. Januar 1929 (Hal Foster)
Buck Rogers 7. Januar 1929 (Dick Calkin)
Popeye, the Sailor 17. Januar 1929 (Elzie Crisler Segar)
Mickey Mouse 13. Januar 1930 (Walt Disney, Floyd Gottfredson)
Donald Duck 30. August 1936 (Al Taliaferro), April 1943 (Walt Disney, Carl Barks)
The Phantom 17. Februar 1936 (Lee Falk)
Prinz Eisenherz 1937 (Hal Foster, ab 1971: John Cullen Murphy)
Spirou 21. April 1938 (Robert Velter, Belgien)
Superman Juni 1938 (Joe Shuster / Jerry Siegel)
Batman Mai 1939 (Bob Kane)
Lucky Luke 12. Juni 1947 (Morris = Maurice de Bevere)
Peanuts 2. Oktober 1950 (Charles Monroe Schulz)
Marsupilami 1952 (André Franquin)
Gaston 1952 (André Franquin)
Johann und Pfiffikus 1952 (Peyo = Culliford Pierre)
Die Schlümpfe, les Schtroumpfs 1957 (Peyo = Culliford Pierre)
Asterix 29. Oktober 1959 (Albert Uderzo und René Goscinny)
The Hulk Mai 1962 (Stan Lee)
Spider-Man August 1962 (Steve Dirk, Stan Lee)
Iznogud 1962 (Jean Tabary und René Goscinny)
Der rosarote Panther 1963
Hägar der Schreckliche 1967 (Dirk Browe)
DEUTSCHLAND, DÄNEMARK UND SCHWEIZ
Struwwelpeter 1844/45 (Heinrich Kinderlieb = Heinrich Hoffmann)
Max und Moritz 1865 (Wilhelm Busch)
Tobias Knopp- Abenteuer eines Junggesellen 1875 (Wilhelm Busch)
Herr und Frau Knopp 1876 (Wilhelm Busch)
Julchen 1877 (Wilhelm Busch)
Globi August 1932 (Robert Lips, Zürich)
Vater und Sohn 1934 (E. O. Plauen = Erich Ohser)
Mecki 1937 (Diehl-Brüder: Puppenserie; Reinhold Escher: Hör Zu)
Lurchi 1937 (Heinz Schubel)
Nick Knatterton Herbst 1950 (Manfred Schmidt)
Rasmus Klump = Petzi 1951 (Vilhelm Hansen, Dänemark)
Fix und Foxi, Lupo, erstmals in Eulenspiegel Nr. 6/1953 (Rolf Kauka)
Sigurd 1953 (Hansrudi Wäscher)
Nick, der Raumfahrer Januar 1958 (Hansrudi Wäscher)
Die Digedags Mai 1956 (Hannes Hegen = Johannes Hegenbarth)
Die Abrafaxe 1976
Werner 1979 (Brösel = Rötger Feldmann)
Das kleine Arschloch 1990 (Walter Moers)
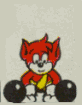
Nun zu den einzelnen Comicfiguren:
International
Über „Yellow Kid“ und die „Katzenjammer Kids“ hatte ich bereits berichtet.
Felix the Cat, der „Kater Felix“ war ein Star der Stummfilmzeit. Er ist eine der wenigen Katzen, die im Comic gut wegkommen (man denke an „Kater Karlo“ oder den ewigen Verlierer Tom bei „Tom und Jerry“). Musiker schrieben Lieder über Felix und Zeitungen interviewten ihn. Seinen magischen Schweif konnte er in alle möglichen Dinge verwandeln. Aber Anfang der 30er wurde er von Popeye, der Mickymaus und Donald Duck verdrängt. Man hat versucht, in wiederauferstehen zu lassen, aber das ist missglückt. Zum Glück für ihn und alle Katzen hat das „Musée du cinéma“ in Quebec seine Filme restauriert und auch seine Comic-Strips werden wieder aufgelegt.
Während des ersten Weltkriegs engagierte William Randolph Hearst für sein New York Journal den jungen Zeichner Elzie Crisler Segar, dessen „Thimble Theater“ bald der Publikumsrenner war. Diese Comic-Strips behandelten die Abenteuer von Olive Oyl und ihres Verlobten Ham Gravy. Der mußte jedoch 1929 einem anderen Platz machen, der in der Gunst der Zuschauer und von Olive Oyl gestiegen war: Popeye (siehe unten).
„Tintin“ (Tim und Struppi) war der erste erfolgreiche francobelgische Comic. Der pfiffige Reporter Tim kommt mit seinen Freunden, seinem lustigen Hund Struppi und dem fluchenden, ungehobelten Käptn Haddock („alle hundertausend heulenden Höllenhunde“, „blistering barnacle“), den trotteligen Detektiven „Schulze und Schultze“ („Dupont et Dupond“) und dem zerstreuten Professor Bienlein (Calculus) in der ganzen Welt herum. Der erste Comic, aus dem man etwas lernen konnte (z. B. dass das Symbol des Evangelisten Johannes der Adler ist etc.) Schließlich landet er, im Jahre 1955, sogar auf dem Mond, 14 Jahren vor den Amerikanern! Tim und Struppi - Homepage
„Tarzan“ war als Roman von Edgar Rice Burroughs bereits so erfolgreich, dass er geradezu nach einer Comic-Adaption schrie. In den Zeiten der Weltwirtschaftskrise gierten die Massen nach so einem weißen Helden. Und die Filme mit dem deutschstämmigen Rekordschwimmer Johnny Weissmueller taten ein Übriges.
„Buck Rogers“ von 1929 war der erste Science-Fiction-Comic
Popeye ist die zweitälteste Comicfigur, die bis heute unverändert existiert. Seine Freundin, Olive Oyl, gab es schon früher (seit 1919 in „Thimble Theater“ praktisch unverändert). Irgendwann ließ Zeichner Elzie Crisler Segar diesen seltsamen Matrosen mit den dicken Unterarmen in seinen Strips auftauchen, der bald zum Star wurde. Seine Kraft bezieht Popeye aus Spinat und Millionen von Kindern mussten dieses widerliche Gemüse essen, weil man davon so stark wird, denn es enthält ja angeblich viel Eisen. Dabei geht das mit dem hohen Eisengehalt des Spinates auf den Tippfehler einer Sekretärin zurück, die bei der Aufzeichnung einer der ersten Analysen des Spinates das Komma versehentlich eine Stelle zu weit rechts setzte, so dass aus 2,2 Milligramm Eisen pro 100 Gramm Spinat 22 Milligramm wurden. Ein Kommentator meinte: „Wäre es Popeye auf das Eisen angekommen, hätte er besser statt des Spinates die Dose aufgegessen.“ Die vernünftigste Person in Popeyes Universum ist sowieso der hochintelligente Wimpy, der ausschließlich von Hamburgern lebt und für diese gesunde Mahlzeit zu fast allem bereit ist.
Über die Mickymaus und Donald Duck ist schon soviel geschrieben und gesagt worden, dass ich hier nichts weiter ausführe. Nur dass Donalds eigentlicher väterlicher Freund nicht Walt Disney, sondern Carl Barks war. Hier die Barks-Base, kommentiertes Werkverzeichnis von Carl Barks (deutsch): Barks-Base Diese und andere anthropomorphen Tiere im Disney-Universum haben sich mit der Zeit doch stark verändert, was aber auch für Lucky Luke, Fix und Foxi und Asterix gilt, nicht jedoch für Popeye, die Superhelden, die Peanuts, sowie, im deutschsprachigen Raum, Globi und Lurchi.
Die Homepage der D.O.N.A.L.D. (Deutsche Organisation der nichtkommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus): WWW.DONALD.ORG
Lustige Taschenbücher von Walt Disney: Lustige Taschenbücher, LTB-Online In den „Lustigen Taschenbüchern“ wird auch immer wieder altes deutsches Kulturgut behandelt, wie z. B. Volkslieder oder Anspielungen aus Oper und Operette.
Die Wirtschaftskrise in den USA schuf eine Art kollektiven Minderwertigkeitskomplex. Da war die Zeit für Superhelden reif. Zuerst kam „The Phantom“, dann Prinz Eisenherz, dann Superman und dann Batman, wobei letztere der populärste wurde, weil er im Grunde auch nur ein einfacher Mensch ist.
1938 wurden „Spirou und Fantasio“ geschaffen.
1947 wurde der Cowboy Lucky Luke von Morris (Maurice de Bevere) geschaffen, der bei uns damals noch der „Fröhliche Fridolin“ hieß und auch ganz anders aussah. Sein Aussehen hat er behalten, ist mittlerweile aber zum Nichtraucher mutiert. Lucky Luke greift immer wieder historische Fakten der damaligen Zeit auf, z. B. den „Kaiser von Amerika“, den es tatsächlich gegeben hat. „Norton der Erste“ regierte in San Francisco und war wahrscheinlich der beliebteste „Kaiser“, den es je gab. „Jeden Sonntag besuchte er eine andere Kirche – um keine Konfession durch seine Gunst zu bevorzugen.“ In einem Nachruf hieß es über ihn: „Kaiser Norton hat niemanden umgebracht, niemanden beraubt und niemanden aus seiner Heimat vertrieben. Das ist mehr als man von den meisten Leuten in seiner Branche sagen kann.“
Die „Peanuts“ („Kleinigkeiten“) von 1950 um den ewigen Verlierer „Charlie Brown“ waren der erfolgreichste Bildstreifen aller Zeiten. Leider ist auch ihr Schöpfer verstorben.
1952 schuf André Franquin das seltsame Fabeltier „Marsupilami“ („Marsupilia“ ist die zoologische Bezeichnung für „Beuteltiere“) und den erfindungsreichen „Gaston“, der sich im Laufe der Zeit (bei Rolf Kauka, dem Förderer francobelgischer Comics, hieß er „Jo-Jo“) doch auch sehr verändert hat. Von Franquin sollte man unbedingt auch „Schwarze Gedanken“ (u-comix) lesen, aber nur, wenn man gute Nerven hat!
Peyo (Culliford Pierre) wurde durch seine Serien Johann und Pfiffikus und Benny Bärenstark bekannt, berühmt wurde er durch die Schlümpfe, Original „Les Schtroumpfs“. Die hatten sogar ihr eigenes Lied. Übrigens wurden alle diese Serien erstmals von Rolf Kauka in „Fix und Foxi“ veröffentlicht.
Asterix ist der Bildungs-Comic schlechthin. Manche Comicforscher, vor allem die Amerikaner, sehen ihn als „nationalistisch“ oder „chauvinistisch“, dabei geht es nur um den alten Kampf Gut gegen Böse. Wie Asterix und Obelix zu ihrem Namen kamen, können Sie hier: http://www.prismenfernglas.de/etymologie.html nachlesen. Hier die offizielle Asterix-Homepage (deutsch)
1962 entstanden die Superhelden des Marvel-Universum, allen voran das grüne Monster „The incredible Hulk“ und „Spiderman“, „Die Spinne“
„Iznogud“ 1962 ist die Geschichte des Großwesirs, der „Kalif anstelle des Kalifen“ werden möchte. Die Hefte lebten vom Humor Goscinnys (wie auch Lucky Luke und Asterix).
„Der rosarote Panther“ wurde erstmals für den Vor- und Abspann des gleichnamigen Films mit Peter Sellers geschaffen (Musik: Henri Mancini)
In „Hägar der Schreckliche“ lernen wir, dass die Erde eine Scheibe ist und Frauen die klügeren Menschen sind.
Und nun zu
DEUTSCHLAND, DÄNEMARK UND SCHWEIZ
Über „Struwwelpeter“ 1844/45 und „Max und Moritz“ 1865 habe ich mich schon ausgelassen.
Tobias Knopp- Abenteuer eines Junggesellen 1875, Herr und Frau Knopp 1876,
Julchen 1877 - Wilhelm Buschs „Familiensaga“ war damals der Renner
Globi August 1932 (Robert Lips, Zürich)
Das ist der älteste, unveränderte Comic im deutschsprachigen Raum. Globi ist ein anthropomorphes Wesen, eine Mischung aus Mensch und Vogel, der stellvertretend für alle Jugendlichen Abenteuer in der ganzen Welt erlebt. Leider werden seine Abenteuer heute nur noch selten aufgelegt.
Vater und Sohn 1934 (E. O. Plauen = Erich Ohser)
Erich Ohser wurde in Plauen geboren, war ein Freund Erich Kästners und musste sich wegen den Nazis ein Pseudonym zulegen. Siehe auch http://www.prismenfernglas.de/etymologie.html . Seine Geschichten von „Vater und Sohn“ sind Bildstreifen ohne Worte und waren weltweit ähnlich erfolgreich wie „Max und Moritz“ oder „Struwwelpeter“. Am Ende werden Vater und Sohn eins mit dem Mond
.
Mecki 1937
Ein anthropomorpher Igel, der das bürgerlich-deutsche vertritt und noch heute in der „Hör Zu“ mit seinen Freunden erscheint.
Lurchi 1937 (Heinz Schubel)
Das Markentier der „Salamander AG“ in Kornwestheim, das nie vergisst, in seinen Abenteuer, die sich immer reimen, den guten Salamander Schuh zu loben. Siehe auch http://www.prismenfernglas.de/etymologie1.html .
In den neuen Lurchi-Abenteuern wird sogar die moderne Schreibschrift berücksichtigt.
Nick Knatterton 1950 (Manfred Schmidt)
Ein an Sherlock Holmes und Philipp Marlowe angelegter Detektiv mit vielen, vollbusigen weiblichen Bekannten. In den 50ern war das sehr gewagt! Leider ist Nick Knatterton beim großen Publikum heute weitgehend vergessen.
Rasmus Klump = Petzi ist ein liebenswerter, kleiner Held, vom dänischen Zeichner Vilhelm Hansen 1951 geschaffen.
Fix und Foxi, Lupo, erstmals in Eulenspiegel Nr. 6/1953 (Rolf Kauka)
Rolf Kauka hat für die Comic-Welt, nicht nur in Deutschland, eine ähnliche Bedeutung wie Walt Disney. Letzterer hatte übrigens diese Bedeutung erkannt und wollte Kauka für 80000 US-Dollar abwerben (zum Vergleich: damals kostete ein VW Käfer etwa 2000 DM!) Rudolf Kauka wurde am 9. April 1917 in Markranstädt bei Leipzig geboren, als es noch keine „Ossis“ gab. Er spürte, dass die Deutschen einen Comic, ganz speziell für ihre Bedürfnisse brauchten. So schuf er das Heft „Till Eulenspiegel“. In „Reineke Fuchs“ (nach Goethe) tauchten erstmals die beiden Füchse Fix und Foxi, sowie ihr Vetter Isegrim, der Wolf (lateinisch lupus, italienisch lupo; sie hieß er dann auch später) auf.
Es entstanden weitere Figuren, wie der Maulwurf Pauli. Außerdem war Kauka der Erste, der die francobelgischen Serien wie die „Schlümpfe“, „Gaston“ („Jo-Jo“) und „Spirou und Fantasio“ („Pit und Pikkolo“) nach Deutschland brachte. Er hatte auch als erster die Rechte an „Asterix“ erworben, überwarf sich jedoch mit dem Dargaud-Konzern, nicht jedoch mit den Machern Uderzo und Goscinny, die bei ihm sogar Zeichner ausleihen wollte, weil diesen Rechteinhabern die zu deutsche Adaption von „Asterix“ nicht passte. Noch heute ist Comicfans diese Adaption ein Dorn im Auge. Als er Ende der 90er sah, wie „Fix und Foxi“ an Niveau verloren und seiner Kontrolle entglitten, zog er die Notbremse. Außerdem kaufte er sich eine Farm mit viel Gelände in den USA, wo man ihn schon immer mehr geschätzt hatte als in Deutschland (siehe das Angebot von Disney). Hier konnte er, bis zu seinem Tod, seinen Hobbies nachgehen, dazu gehörten Dendrologie (Baumforschung) und Baggerfahren.
Auch Fix und Foxi haben mit der Zeit ihr Aussehen geändert.
Sein Erbe lebt weiter in den Figuren von „Knax“, dem Comic der Sparkassen, das sein Mitarbeiter Fred Kipka betreut.
„Sigurd“ von 1953, ein mittelalterlicher Held und „Nick , der Raumfahrer“ im Januar 1958 sind beide Schöpfungen von Hansrudi Wäscher, der damit auf die Trends der Zeit (und auf den „Sputnik-Schock“, siehe auch http://www.prismenfernglas.de/raumfahrt.html ) reagierte.
Die Digedags wurden von Johannes Hegenbarth geschaffen, der sich Hannes Hegen nannte. 1956 schickte der Zeichner drei Kobold-Menschlein in der Zeitschrift „Mosaik“ auf eine unendliche Reise durch Raum und Geschichte, die Dig, Dag und Digedag überall dorthin führte, wo andere DDR-Geschöpfe selten anzutreffen waren: nach Amerika, ins alte Rom, an des Sonnenkönigs Hof, nach England zu James Watt, ins Weltenall und auf die Düppeler Schanzen.
1976 hatte Hegen, wiederholt ideologisch gegängelt, die Nase voll und schmiss den Griffel hin. Seine Nachfolger kreierten die „Abrafaxe“, Abrax, Babrax und Califax. Die überstanden sogar die Währungsunion.
1979 schuf Rötger Feldmann, der sich „Brösel“ nennt, aus seinen Jugenderlebnissen den Antihelden „Werner“, der bald der Deutschen liebster Bildstreifen wurde.
„Das kleine Arschloch“, noch so ein Antiheld, wurde 1990 von Walter Moers kreiert, der auch für „Käptn Blaubär“ verantwortlich zeichnet.
Soviel zu den einzelnen Comics und zur Comicgeschichte. Hier einige weiterführende Links:
Theorie und Geschichte des Comics
Lustige Taschenbücher, LTB-Online
Größtes Deutsches Comicforum: http://www.comicforum.de/comicforum/
Aktuelle Comic-Neuigkeiten: http://www.t-online.de/lifestyl/index/kullix06.htm
Und, last, but not least, meine eigene Seite zum Timbuktu-Mythos in Comics:
http://www.prismenfernglas.de/comic.html